Seit Gründung des RHET AI Centers gehört das Journalist-in-Residence Programm (kurz JIR) fest zu unserem Jahresprogramm. Gemeinsam mit Cyber Valley ermöglichen wir Journalist:innen einen längeren Forschungsaufenthalt bei uns in Tübingen, um an einem Thema an der Schnittstelle KI und Journalismus zu arbeiten. Im Frühjahr 2025 können sich interessierte Journalist:innen erneut mit einem konkreten Forschungsvorhaben bewerben.
Während ihrer Zeit in Tübingen und bei Cyber Valley haben die Journalist:innen die Möglichkeit, sich mit Forschenden aus dem Bereich Künstliche Intelligenz auszutauschen, Netzwerke zu knüpfen und vom Arbeitsumfeld sowie der Expertise im Cyber Valley und RHET AI zu profitieren. In den vergangenen Jahren konnten wir Prof. Christina Elmer, Julia Merlot (beide SPIEGEL), Bettina Friedrich (MDR), Tobias Asmuth (frei) und Elena Riedlinger (WDR) als JIRs bei uns begrüßen, 2024 dann Willem de Haan (MDR) und Dr. Anna Henschel (wissenschaftskommunikation.de).

Doch was motiviert Journalist:innen dazu, sich für mehrere Monate mit einem Thema auseinanderzusetzen und dafür nach Tübingen zu ziehen? Wie läuft der Weg ins Programm ab und wie arbeiten die Journalists-in-Residence dann tatsächlich vor Ort?
'Das fragt man doch am besten die Journalist:innen selbst!', dachten wir uns und haben uns im Verlauf ihres Aufenthaltes einige Male mit Anna Henschel und Willem de Haan getroffen.
Die Journalists-in-Residence 2024

Dr. Anna Henschel
Anna Henschel sieht die sprachliche Vermenschlichung von KI als große kommunikative Herausforderung, besonders durch bildhafte Sprache. In ihrer Recherche ging sie der Frage nach, welche sprachlichen Alternativen es gibt.
"Es ist ein verständlicher Impuls, Künstliche Intelligenz zu vermenschlichen, wenn wir sie erklären wollen. Ich möchte herausfinden, wie wir das Thema KI journalistisch begleiten können, ohne Missverständnisse zu begünstigen."
Willem de Haan
Willem de Haan hat zu KI-gestütztem Zielgruppentesting für journalistische Inhalte geforscht. Denn die Gewährleistung von Reichweite und die Orientierung an Nutzerbedürfnissen werden im Journalismus immer wichtiger.
"Können KI-gestützte Tools bei der Optimierung der Distribution unterstützen und wenn ja, in welchem Umfang?"

Beginn des Journalist-in-Residence Programm
Willem, Anna, auch von Redaktionsseite: Herzlich Willkommen am RHET AI! Als erstes wollen wir von euch wissen: Wie habt ihr vom Programm gehört und warum habt ihr euch beworben?
Anna Henschel: Durch meine Arbeit und meine LinkedIn-Bubble war mir das Journalist-in-Residence Programm ein Begriff. Auch von Elena Riedlinger, meiner Vorgängerin im Programm, hatte ich davon gehört und habe dann beschlossen, mich mit meinem Thema zu bewerben.
Als Redakteurin bei Wissenschaftskommunikation.de habe ich in den letzten zwei Jahren beobachtet, wie KI als Thema in den Medien immer präsenter geworden ist. Auch in den Redaktionen wurde – vor allem nach dem Hype um ChatGPT – immer wieder die Frage gestellt, welche Veränderungen KI für das journalistische Feld mitbringt. Vermisst habe ich dabei aber immer wieder die Frage danach, wie wir über KI berichten, vor allem, welche Rolle die Sprache dabei spielt.
Willem de Haan: Anders als Anna hatte ich bis vor drei Jahren nichts vom Programm gehört. Dann hat mir meine Kollegin Bettina Friedrich davon erzählt, die vor zwei Jahren selbst JIR hier war. Das Programm hat mich von Anfang an sehr interessiert und ich habe immer wieder mitverfolgt und beobachtet, was dazu veröffentlicht wird.
KI und Journalismus ist ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Jahren viel beschäftigt habe. Ich arbeite beim MDR, zwar nicht mehr als Programmschaffender, sondern in der Prozessbegleitung, ‑Entwicklung und ‑Beratung und gehe dort vor allem der Frage nach, wie wir als MDR und ARD die Verbreitung unserer digitalen Angebote verbessern können. Also wie es uns gelingen kann, die Inhalte so zu gestalten und zu verbreiten, dass sie auf die Bedarfe unserer Nutzenden zielgerichtet passen. Daraus hat sich dann auch meine Forschungsfrage für das Programm am Cyber Valley ergeben, nämlich wie wir Journalisten KI nutzen können, um die Reichweite journalistischer Angebote zu stärken.
Check-in während des JIRs
Bisherige Erfahrungen
Jetzt seid ihr schon eine Zeit lang hier in Tübingen. Wie waren die ersten Wochen eurer Journalist-in-Residence Zeit? Und wie können wir uns euren Arbeitsalltag hier vorstellen?
AH: Zu Beginn wurden wir direkt mit den relevanten Schlüsselpersonen innerhalb des Cyber Valley und des RHET AI vernetzt. Praktisch habe ich viele Hintergrundgespräche zu meinen Themen geführt, durfte aber auch einige Fachtagungen und Konferenzen besuchen und mich mit den Forschenden dort austauschen. Darüber hinaus habe ich auch einfach viel gelesen, mich in das Forschungsfeld eingearbeitet und ganz klassisch recherchiert. Die Inhalte aufzubereiten und bei verschiedenen Gelegenheiten zu präsentieren gehört dann auch noch zu meinem Arbeitsalltag hier. Willem, du hast das mal so schön gesagt: Man hat hier die Zeit, sich wirklich tiefgründig mit einer hochrelevanten Frage zu beschäftigen, für die sonst im Medienalltag zu wenig Raum wäre und die dort schlichtweg untergeht.
WdH: Dem kann ich nichts hinzufügen, genau so war und ist es auch für mich. Was ich darüber hinaus als große Bereicherung erlebe, ist, dass wir beide gemeinsam und zur gleichen Zeit als JIRs hier sind. Ich durfte auf jeden Fall schon viele wertvolle Gedanken aus dem Austausch mit Anna mitnehmen und dieses Gegenseitig-Impulse-Geben ist auf jeden Fall sehr bereichernd.
Man erfährt im Austausch mit den Forschenden auch, was alles schon im Bereich der Künstlichen Intelligenz passiert, und daraus ergeben sich immer wieder neue Impulse und Kontakte, auch mit Kolleg:innen aus dem Journalismus oder Praxisanwender:innen. Ich fand es auch sehr spannend zu sehen, dass hier viele unterschiedliche Disziplinen KI in ihre bestehenden Strukturen integrieren und es nicht nur etwa auf ML reduziert ist. Aus dieser breiten Perspektive ergeben sich auch spannende Synergieeffekte. Deshalb finde ich es auch wichtig, wirklich vor Ort in Tübingen zu sein.
Forschungsprojekt Anna Henschel
Ihr arbeitet ja an unterschiedlichen Fragestellungen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen tiefer in euren jeweiligen Arbeitsprozess mit hineinnehmt.
Starten wir mit dir, Anna. Du beschäftigst dich mit der Frage, wie die Vermenschlichung von Künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Kommunikation vermieden werden kann und welche Rolle Metaphern dabei spielen. Was ist gemeint, wenn wir von Vermenschlichung sprechen und welche Sprachmuster treten dabei auf?
AH: Vermenschlichung bedeutet, dass Objekten menschliche Emotionen, Fähigkeiten und Intentionen zugeschrieben werden. In der Fachsprache sagt man dazu "Anthropomorphismus". Das können wir zum Beispiel bei ChatGPT gut beobachten, wenn wir Formulierungen nutzen wie: "ChatGPT sagt" oder "ChatGPT denkt". Interessanterweise passiert diese Vermenschlichung nicht nur bei Lai:innen, sondern es ist auch die Fachsprache, die vermenschlicht. Also zum Beispiel Machine Learning, oder natürlich der Begriff Künstliche Intelligenz.
Wenn also schon die Fachsprache vermenschlicht, ist es kein Wunder, dass die Medien das aufgreifen. Das setzt sich dann in den Metaphern fort, mit denen wir KI beschreiben. Es ist wirklich spannend zu beobachten: Wenn man beispielsweise Forschende bittet, einen Prozess wie etwa "Reinforcement Learning" zu erklären, dann beginnen sie stets mit so etwas wie: "Das kann man sich vorstellen wie ein Kind, das…" Wenn man sie fragt, warum sie diese Vermenschlichung vorgenommen haben, kommt oft die Antwort: "Oh, ich wollte gar nicht anthropomorphisieren." Aber irgendwie ist das so tief in unserem Sprachgebrauch verankert, dass wir uns nur sehr schwer davon lösen können.
Warum ist Vermenschlichung denn ein problematisches Phänomen?
AH: Ich würde nicht sagen, dass es immer problematisch ist. Es ist problematisch, wenn man nicht darüber reflektiert, was dieses sprachliche Bild mittransportiert. Es gibt sicherlich Szenarien, in denen es angebracht ist und auch in den richtigen Kontext gerückt wird. Aber meistens passiert das nicht und das hat auf jeden Fall Effekte. Auch dazu gibt es mittlerweile Forschung, dass beispielsweise Politiker:innen und Stakeholder:innen Entscheidungen in eine spezifische Richtung treffen, wenn Expert:innen mit ihnen über KI kommunizieren und zum Beispiel menschliche Metaphern nutzen.
Wenn du deine Recherche jetzt betrachtest, welche Lösungsansätze siehst du für deine Forschungsfrage? Wo und von wem können sie konkret umgesetzt werden?
AH: An die Journalist:innen gerichtet: Man könnte in Interviews mit Expert:innen Vorschläge für Erklärungen zu KI-Themen machen und ihr Feedback dazu einholen. Zudem gibt es ein paar Checklisten zur besseren Berichterstattung über KI. Die könnte man noch weiter zirkulieren und vielleicht auch kritisch besprechen.
Welche Aufgaben siehst du bei der Wissenschaftskommunikation und auch dem Wissenschaftsjournalismus in diesem Themenfeld?
AH: Wissenschaftskommunikator:innen sehe ich da besonders in der Verantwortung, weil sie als Brücke zwischen Gesellschaft und Forschung fungieren. Es ist manchmal schwierig, Kommunikator:innen und Journalist:innen zusammenzubringen. Ich denke aber, dass beide Seiten davon profitieren können, sich auszutauschen und zu überlegen, wie wir vertrauensvoll und transparent über KI sprechen können.
Vielen Dank für die Einblicke in dein JIR-Projekt.


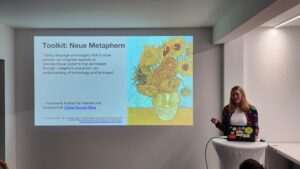

Forschungsprojekt Willem de Haan
Willem, du beschäftigst dich mit der Frage, wie Journalist:innen KI nutzen können, um die Reichweite journalistischer Angebote zu stärken. Was können wir uns denn konkret darunter vorstellen?
WdH: Ganz grundsätzlich geht es in meiner Recherche darum, wie wir es als Medienanbieter schaffen können, unsere Inhalte einerseits so zu gestalten und andererseits zu verbreiten, dass wir die wirklichen Bedarfe der Mediennutzenden adressieren. Dazu gehört auch die Frage, wo die adressierten Nutzenden Medien konsumieren, in welcher Situation und wie? Der Prozess, diese Fragen zu beantworten, ist sehr ressourcenaufwändig und kommt zum normalen journalistischen Geschäft noch dazu, deshalb ist das in den letzten Jahren auch oft viel zu wenig beleuchtet worden.
Davon ausgehend habe ich mich gefragt, inwiefern wir Künstliche Intelligenz und Sprachmodelle nutzen können, um diese Aufgaben im Bereich Distribution zu übernehmen und so ressourceneffizienter zu arbeiten. Es geht dabei nicht um das Ersetzen von Journalist:innen, sondern darum, deren Arbeit klug zu ergänzen mehr Raum zu schaffen für die eigentliche journalistische Arbeit und vor allem für die kreative Arbeit des Berufs.
Wenn du jetzt mit deiner Recherche im Hinterkopf auf das Thema blickst: Welche Möglichkeiten und Ansätze siehst du dafür? Und noch größer gefragt: Wo siehst du die Möglichkeit der Anwendung von KI-Tools im Journalismus in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
WdH: Ich sehe in allen Prozessschritten der journalistischen Arbeit die Möglichkeit, KI-Tools anzuwenden. Die Zeit, die wir dadurch gewinnen, können wir als Journalist:innen dann wiederum in qualitative Prozesse investieren. Wenn ich speziell meinen Arbeitsbereich betrachte, nehme ich mehrere konkrete Ansätze mit. Zum Beispiel etwa den Einsatz von KI, um die Personalisierung von journalistischen Inhalten zu stärken, Inhalte anzupassen oder schlichtweg erstmal zu erstellen.
Personalisierung bedeutet aber auch, für unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten Inhalte in unterschiedlichen Formaten anzubieten. Ein Ziel wäre, dass Angebote entstehen, die für alle offen und zugänglich sind und auch für verschiedene Zugangsarten verschiedene Varianten anbieten. Auch dabei kann die Anwendung von Sprachmodellen unsere Arbeit unterstützen.
Aus deinen Antworten höre ich heraus, dass eine Form von Co-Kreativität im Journalismus in der Zukunft unumgänglich sein wird. Wo siehst du Chancen und Schwierigkeiten dabei?
WdH: Chancen sehe ich einige und zwei davon möchte ich ganz deutlich benennen. Das ist zum einen die große Herausforderung, mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit für unsere öffentlich-rechtlichen Inhalte zu bekommen. Dabei geht es auch um das Erreichen der Nutzenden. Das ist eine große Herausforderung, der wir aber begegnen können, indem wir uns intensiv mit den Menschen, die wir adressieren, beschäftigen. Und das tun wir auch, aber eben nicht intensiv genug, weil das im Regelbetrieb leider untergeht. Das liegt unter anderem an einer Doppelbelastung, die dadurch entsteht, dass wir das lineare Programm weiterführen müssen und gleichzeitig die Anforderung besteht, uns im digitalen Raum weiter zu entwickeln. Dafür sind nicht genug Ressourcen vorhanden und deshalb gelingt es uns auch noch nicht gut genug im digitalen Raum, dort wo die jungen Nutzer:innengruppen unterwegs sind, zu agieren.
Wenn wir hier KI nutzen, können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen schaffen wir die Anpassung unserer Inhalte an die Bedürfnisse der Menschen besser. Zum anderen werden dadurch Ressourcen frei, die wiederum in kreative Prozesse investiert werden können, die momentan zu kurz kommen. Wir können also insgesamt durch Integration von KI-Tools in den journalistischen Arbeitsprozess Journalist:innen entlasten und die Qualität unserer Angebote erhöhen.
Ein Risiko besteht im unkritischen Einsatz von Sprachmodellen in den Prozessen. Das ist allerdings kein Journalismus-spezifisches Problem, sondern in allen Anwendungsbereichen zu finden. Das ergibt sich, dass wir Sprachmodelle nach dem Prinzip "machine in the middle" einsetzen müssen, also am Anfang und am Ende des Prozesses sollte immer ein Mensch eingebunden sein. So wird gewährleistet, dass Ergebnisse immer kritisch überprüft werden, damit sie den Erwartungen, journalistischen Richtlinien, und bei uns in der ARD auch der Verpflichtung zum Gemeinwohl, gerecht wird.
Rückblick auf das Journalist-in-Residence Programm
Danke euch beiden für den Einblick in eure Recherche! Wie blickt ihr auf eure Ergebnisse und wie werdet ihr damit jetzt weiterverfahren?
AH: Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse lässt sich leicht in die Praxis umsetzen: Es hilft enorm, sich genau anzuschauen, mit welcher Art von KI man es zu tun hat, und dann nach einer passenden, differenzierten Metapher dafür zu suchen. Das führt automatisch zu einem präziseren Denken und damit zu einer besseren Berichterstattung.
Außerdem habe ich aus den Gesprächen mit Expert:innen viele gute Ideen zur Weiterverbreitung mitgenommen. So habe ich zum Beispiel den Wikipedia-Eintrag über KI um Informationen über Metaphern ergänzt. Basierend auf meinen Erkenntnissen habe ich auch Blattkritiken gemacht und Präsentationen für Wissenschaftskommunikator:innen gegeben.
WdH: Ich blicke einerseits zufrieden und gleichzeitig auch kritisch auf meine Rechercheergebnisse. Ganz grundsätzlich nehme ich die Empfehlung an alle Journalist:innen mit, bei der Nutzung von Sprachmodellen die Bedürfnisse der Nutzenden immer wieder mitzudenken, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, bessere Ergebnisse zu erzeugen. Im Speziellen geht um es den Vorgang der In-Context-Impersonation, also der Übergabe einer definierten Rolle an ein Sprachmodell, u. a. damit die Bedürfnisse einer adressierten Zielgruppe berücksichtigt werden können. Das nehme ich als besonderes Learning mit und werde es für den Kreis meiner Kolleg:innen mit Details untersetzen und kommunizieren.
Und über eure Rechercheergebnisse hinaus, wie schaut ihr jetzt gegen Ende eures Aufenthalts auf die Zeit hier als Journalists-in-Residence zurück?
AH: Positiv. Es war eine tolle Erfahrung, ich hatte fast jeden Tag interessante Gespräche mit Forschenden. Für mich hat sich daraus eine komplette Wandlung für meine künftige Berichterstattung über KI ergeben: Ich habe eine viel größere Sensibilität für meine Sprache, Anthropomorphismen und nehme auch Ideen für weitere Projekte mit. Jetzt freue ich mich aber erstmal noch auf die letzten Wochen hier. Gerade läuft noch meine Umfrage, deren Ergebnisse ich in meiner Abschlusspräsentation vorstellen werde.
WdH: Dem schließe ich mich an. Ich schaue durchweg positiv auf die Zeit in Tübingen zurück. Ich habe viel über KI dazugelernt, insbesondere im Hinblick auf meine Fragestellung zur Stärkung von Reichweite journalistischer Angebote. Ich bin beeindruckt vom Kontakt mit der gesammelten Expertise, die hier in Tübingen aus den verschiedensten Disziplinen und Perspektiven auf KI vertreten ist. Das war eine sehr inspirierende und aktivierende Atmosphäre hier und durch die Möglichkeit, sich zu fokussieren eine sehr wertvolle Zeit und Erfahrung. Eine so kompakte Studienzeit, in der man die Gelegenheit hat, sich ohne Ablenkungen in ein Thema zu vertiefen, ist, abgesehen von einem Studium, einmalig.
Das freut uns natürlich sehr zu hören. Was nehmt ihr denn für euch an bedeutenden Learnings aus der Zeit hier mit?
WdH: Eine sofortige Erkenntnis, die ich gewonnen habe, als ich hier ankam war, dass Künstliche Intelligenz viel mehr ist als das, womit wir uns im Alltag oder auch im Kontext unserer beruflichen Aufgaben beschäftigen. Auf den Journalismus bezogen nehme ich mit, dass in der Disziplin zwar viel über den Einsatz von KI gesprochen wird, aber viel zu wenig darüber, wie wir KI einsetzen können, um die Bedürfnisse unserer Nutzenden zu erfüllen.
Und zuletzt ist für mich die Erkenntnis wichtig, dass es für uns als Journalist:innen keine Alternative für den Einsatz von KI in unserer Arbeit gibt, auch nicht aus Perspektive des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Nur wenn in diesem Bereich ausreichend investiert wird, in Ausbildung, Wissen, Anwendungen und Angebote, haben wir dauerhaft die Chance, erfolgreich auf die Verwerfungen zu reagieren, die sich durch die Digitalisierung der Medienlandschaft ergeben.
AH: Ein wichtiges Learning für mich war, dass diese Frage, welche Metaphern geeignet sind, um über KI zu sprechen, nicht nur eine Frage für den Journalismus ist. Denn egal, welcher Gruppe von Menschen ich das vorgestellt habe, ob Forschenden, Kommunikator:innen, Menschen aus meinem Umfeld: Die Reaktion war immer, dass es ein super spannendes Thema ist, das die Menschen auch direkt betrifft.
Fazit
Danke euch fürs Teilen. Dann bleibt zuletzt nur noch die Frage nach eurem Fazit zum Programm und ob ihr es Kolleg:innen weiterempfehlen würdet?
AH: Ich kann es jede:r Kolleg:in nur empfehlen. Es ist ein wertvolles Programm, in dem man seinen Fragen nachgehen kann, die im Redaktionsalltag zu kurz kommen. Dafür bekommt man hier die Ressourcen und die Unterstützung und wird von allen Seiten herzlich willkommen geheißen.
WdH: Ich stimme Anna zu, ich würde es allen ans Herz legen. Es gibt, glaube ich, keine oder wenig bessere Optionen, sich als Journalist:in tiefgehend mit dem Thema KI zu beschäftigen als hier im Programm. Jede:r Journalist:in, der oder die sich Expertise im Feld der KI aneignen möchte, sollte überlegen, sich hier im Journalist-in-Residence Programm zu bewerben.
Vielen Dank euch beiden für eure tolle Arbeit hier und dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns immer wieder Einblicke zu gewähren. Wir wünschen euch alles Gute für die Zeit nach dem Programm und hoffen, ihr könnt die Erkenntnisse aus Tübingen positiv in euren eigentlichen Arbeitsalltag mitnehmen.
Nachtrag: Anna Henschel hat ihre Forschungsergebnisse und Erlebnisse in Tübingen in einem Artikel bei wissenschaftskommunikation.de festgehalten. Interessierte finden den Artikel dort unter dem Titel "Das Problem mit der Intelligenz".
Bewerbungen bis 24.04.25 möglich!
Bis zum 24. April 2025 läuft die diesjährige Bewerbungsrunde für das Journalist-in-Residence Programm. Wenn Sie also Interesse haben, 2025 bei uns am RHET AI und Cyber Valley als Journalist:in zu Gast zu sein, bewerben Sie sich gern. Alle Informationen dazu finden Sie hier.






